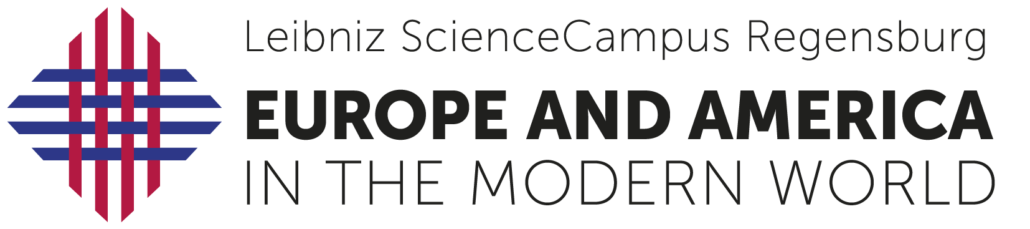The essay is in German.
Mexikos Gesellschaftspyramide mit Trotzki als Retter – Wandgemälde von Diego Rivera, © Klaus Buchenau
Generate PDF
Nicht jeder Vergleich zwischen Regionen ist sinnvoll – die Fidschi-Inseln und die osteuropäischen Staaten etwa sind so unterschiedlich, dass Vergleichen das eigentlich nur bestätigt. So kontrollieren die Fidschi-Inseln ihre Grenzen, wenn überhaupt, mit Booten, wogegen die EU-Außengrenzen im östlichen Europa mit Zäunen und Kameras überwacht werden – aber dieser Befund lehrt uns nichts über menschliche Gesellschaften, denn der unterschiedliche Grenzschutz ist hier keine menschliche Wahl, sondern vor allem eine Folge der natürlichen Gegebenheiten. Interessant sind vielmehr Fälle, wo unter vergleichbaren Ausgangsbedingungen unterschiedliche Ergebnisse entstehen.
Unterschiedliche Imperien, unterschiedliches Erbe
Im Rahmen der großen globalen Kräfteverschiebung und des relativen Bedeutungsverlusts des Westens gibt es in beiden Regionen die Hoffnung, dadurch selbst zu mehr globaler Sichtbarkeit und „Respekt“ aufsteigen und damit auch aus dem Anpassungsmodell aussteigen zu können. Ein Zeichen dieser Stimmung sind die „Populismen“ in beiden Regionen, zu deren Kerngeschäft es gehört, die so empfundenen Hegemonen öffentlich zu provozieren, wenn nicht gar vorzuführen.
Osteuropa und Lateinamerika weisen eine Reihe von ähnlichen Kontexten auf, die es ermöglichen, schärfere analytische Fragen zu stellen. Beides sind postkoloniale Räume, in denen die Dekolonialisierung ungefähr zur gleichen Zeit stattgefunden hat, siehe etwa die Unabhängigkeitserklärungen in Lateinamerika und in Südosteuropa, die im Wesentlichen ins 19. Jahrhundert fallen (Russland fällt als Land mit bis heute imperialen Zügen etwas aus dem Schema; aber immerhin fühlt es sich ebenfalls vom Westen kolonialisiert). In beiden Regionen wurde nach der Unabhängigkeit das europäische Modell des demokratischen Nationalstaats emuliert, was hier wie dort erhebliche Friktionen zwischen politischem Modell und gesellschaftlicher Realität erzeugte. In beiden Regionen gibt es eine Selbstsicht als Peripherie, die sich einem Zentrum gegenübersieht – in Lateinamerika ist dies vorrangig die USA (das den Namen „Amerika“ für sich usurpiert, im östlichen Europa vor allem Westeuropa (welches sich mit „Europa“ gleichsetzt). In beiden Regionen wird von diesem Zentrum oft als imperial gesprochen, hier wie dort lässt sich diese Beziehung als ambivalent beschreiben, als Gratwanderung zwischen Bewunderung, Ressentiment, pragmatischer Kooperation und lebensweltlicher Synthetisierung. Bei beiden Regionen wird – im Rahmen der heute wieder aktuellen Kulturkampftheorien im Gefolge von Samuel Huntington debattiert – ob es sich überhaupt um eigene Zivilisationen oder nicht doch eher um „Filialen“ des Westens handelt, die sich im Rahmen einer erfolgreichen Transition vollkommen an das westliche Zivilisationsmodell anpassen (werden). Ostasien oder die islamische Welt werden deutlich anders angefasst, die Frage einer zukünftigen Konvergenz wird hier meistens gar nicht gestellt.
Dieser Position ist aber in den letzten zwei Jahrzehnten ein starkes Contra erwachsen: Im Rahmen der großen globalen Kräfteverschiebung und des relativen Bedeutungsverlusts des Westens gibt es in beiden Regionen die Hoffnung, dadurch selbst zu mehr globaler Sichtbarkeit und „Respekt“ aufsteigen und damit auch das Anpassungsmodell verlassen zu können. Ein Zeichen dieser Stimmung sind die „Populismen“ in beiden Regionen, zu deren Kerngeschäft es gehört, die so empfundenen Hegemonen öffentlich zu provozieren, wenn nicht gar vorzuführen.
Vor dem Hintergrund dieser osteuropäisch-lateinamerikanischen Parallelen treten dann aber auch die Unterschiede umso kraftvoller hervor. Die gleichsetzende Feststellung, es handle sich um postimperiale Räume, bleibt nichts weiter als eine Nebelkerze, solange dabei nicht die Unterschiede zwischen kontinentalen und maritimen Imperien berücksichtigt werden. Zwar sind alle Imperien pyramidal aufgebaut, behandeln die angesammelten Gruppen und Territorien nach gewissen Ad-hoc-Prinzipien, die oft „Diversitätsmanagement“ genannt werden; weil sie durch eine zumeist absolutistische monarchische Spitze und ihr loyale Eliten zusammengehalten werden, sind sie weder demokratiekompatibel noch können sie konsequent soziale Gerechtigkeit anstreben.
Trotz dieser Gemeinsamkeiten, auf welche der postkoloniale Ansatz abhebt, macht es allerdings einen Unterschied, ob jemand im 18. Jahrhundert Untertan des Habsburgerreiches, des Osmanischen oder Russischen Reiches war, oder eben des Spanischen Kolonialreichs.
Trotz dieser Gemeinsamkeiten, auf welche der postkoloniale Ansatz abhebt, macht es allerdings einen Unterschied, ob jemand im 18. Jahrhundert Untertan des Habsburgerreiches, des Osmanischen oder Russischen Reiches war, oder eben des Spanischen Kolonialreichs. In den Kontinentalreichen war die geographische wie auch die soziale Nähe zwischen der dominanten und den beherrschten Gruppen sowie die soziale Mobilität größer. In Mittel- und Südamerika dagegen errichteten die spanischen Statthalter eine schwer zu durchbrechende Grenze gegenüber allen anderen, sogar gegenüber den bereits in den Amerikas geborenen Spanischstämmigen, und noch mehr gegenüber den indigenen Völkern und den aus Afrika importierten Sklaven und deren Nachkommen. Diese Gesellschaftsordnung, oftmals mit dem Begriff des Kastenwesens assoziiert, wurde durch exakt definierte Ausbeutungsinteressen aufrechterhalten. Die Edelmetalle, die in Lateinamerika von Menschen auf den untersten Stufen der sozialen Pyramide unter erheblichem Zwang und Gewaltanwendung abgebaut wurden, füllten die Tresore an der Spitze der Pyramide. Dieses Imperium hinterließ nach seinem Abgang nicht nur eine extrem steile und ausdifferenzierte soziale Ordnung, es förderte auch Fluchtbewegungen der am meisten bedrängten Bevölkerungsteile in Hochgebirge, Dschungel und Wüsten, wo sowohl indigene als auch afro-amerikanische Gruppen ihre Distinktheit behaupteten und befestigten. Als mittleres Glied bildete sich ein ethnisch gemischtes Stratum, das meist aus der Verbindung zwischen männlichen Europäern und weiblichen Indigenen und seltener Schwarzen entstammte. In vielen Ländern Lateinamerikas bilden die meist mestizos (Mischlinge) genannten Menschen heute die Mehrheit. Der mexikanische Intellektuelle José Vasconzelos prophezeite 1925, den Mestizen werde als „kosmische Rasse“ eine globale Führungsrolle zukommen. In der Realität der lateinamerikanischen Staaten ist davon nicht viel zu spüren, in der Regel wird ein höherer sozialer Status mit hellerer Haut assoziiert, und der Aufstieg durch Heirat in „weiße“ Kreise wird blanquearse (weiß werden) genannt.
doi number
doi: 10.15457/frictions/0029
„Spanier und India ergeben Mestizo“, unbekannter Autor, Ende 18./Anfang 19. Jahrhundert, © Wikipedia public domain
Strukturelle Kontinuität nach der Unabhängigkeit in Lateinamerika
In den ehemaligen spanischen Kolonien bedeutet die Unabhängigkeit nicht, dass eine bislang zweitrangig behandelte ethnische Gruppe das Ruder übernommen hätte, im Gegenteil. Die schon vor der Unabhängigkeit tonangebenden Kreolen, also die in Lateinamerika geborenen Nachkommen europäischer Siedler, erweiterten lediglich ihre Macht, weil sie ihre von der spanischen Krone entsandten Aufseher losgeworden waren.
Auch in den Kontinentalreichen war die Realität, gemessen an den Idealen der Französischen Revolution, keineswegs egalitär. Allerdings funktionierte die Elitenreproduktion des Russischen, Osmanischen oder Habsburger Reiches nach weitaus offeneren Prinzipien – hier konnten „Fremdstämmige“, sofern sie nicht ohnehin zu führenden ethnisch-sozialen Gruppe gehörten, unter bestimmten Voraussetzungen Zugang zu den höchsten Posten des Reiches erhalten – Loyalität war hier oft wichtiger als die ethnische Abstammung. Im Spanischen Kolonialreich blieb dergleichen undenkbar. Trotz des oben erwähnten mestizaje blieben Ämter in Verwaltung, Kirche sowie der große Landbesitz den Europäischstämmigen vorbehalten, die politisch und wirtschaftlich besonders zentralen Aufgaben lagen in den Händen von aus Spanien entsandten Emissären, Günstlingen des Königshauses.
Hinter diesen Unterschieden standen auch unterschiedliche Grundlogiken – während die Expansion der Kontinentalreiche oft durch das Streben nach einer militärisch gut absicherbaren Grenze angetrieben wurde, waren die spanischen und portugiesischen Eroberungen stark von merkantilen Logiken motiviert. Letzere brachten die Conquistadoren dazu, fremdstämmige Bevölkerungen zu versklaven; das kam auch in Kontinentalreichen vor, hier allerdings konterkariert durch den Aufbau militärischer Allianzen, woraus sich Aufstiegschancen für die Kolonisierten ergaben.
Im Zuge der Dekolonialisierung verschwanden die Unterschiede zwischen den Imperien keineswegs. In den Nachfolgestaaten der europäischen Landreiche fand ein partieller Elitenwechsel statt: Die Angehörigen der „imperialen Völker“ (Russen, Deutsche, osmanische Türken) mussten Platz machen für eine neue, aus den Titularnationen rekrutierte Elite, die sich in Teilen schon während des Imperiums warmgelaufen hatte, dank der relativen sozialen Durchlässigkeit der Kontinentalreiche. Hier spielte auch eine Rolle, dass die Kontinentalreiche, anders als Spanien und Portugal, oft darauf verzichtet hatten, die Fremdstämmigen zu ihrem Glauben zu bekehren oder ihnen die eigene Sprache aufzuzwingen. So beherrschten Russland, das Habsburger und das Osmanische Reich im 18. Jahrhundert weite Territorien, in denen an sich „nicht-führende“ Ethnien dominierten, deren lokale Eliten in die Herrschaftsstrukturen des Imperiums inkorporiert wurden. Diese verwalteten sich über ihre eigenen religiösen Institutionen selbst und pflegten die eigene Sprache, die sie teils auch weiterentwickeln konnten.
In den ehemaligen spanischen Kolonien bedeutet die Unabhängigkeit nicht, dass eine bislang zweitrangig behandelte ethnische Gruppe das Ruder übernommen hätte, im Gegenteil. Die schon vor der Unabhängigkeit tonangebenden Kreolen, also die in Lateinamerika geborenen Nachkommen europäischer Siedler, erweiterten lediglich ihre Macht, weil sie ihre von der spanischen Krone entsandten Aufseher losgeworden waren. Alsbald spalten sie sich in Liberale und Konservative, wobei erstere Wert auf bürgerliche Freiheiten und formale rechtliche Gleichheit legten, letztere dagegen vorrangig die gesellschaftliche Pyramide aus der Kolonialzeit – und damit die eigenen Privilegien – absichern wollten. Die Liberalen waren immerhin so einflussreich, dass die lateinamerikanischen Staaten (bis auf Brasilien) sich zunächst als demokratische Republiken konstituierten und die Sklaverei abschafften. An der steilen sozialen Pyramide änderte das aber nichts: Wer vorher auf der Hacienda weißer Europäischstämmiger geschuftet hatte, tat dies meist auch hinterher. Die Sklaverei, sofern sie noch bestand, wurde zwar abgeschafft, aber aus den freigelassenen schwarzen Sklaven wurden jetzt ebenfalls arme Landarbeiter, sofern sie sich nicht, wie viele Indigene, in besonders unwirtliche Gegenden zurückzogen, um die direkte Herrschaft der landbesitzenden Oberschicht abzuschütteln.
Tiefenethnisierung: Mesrop Mashtots empfängt die armenische Schrift, Gemälde von Stepanos Nersisyan (1882), Public Domain, via © http://www.panoramio.com/photo/56482614
In den jungen lateinamerikanischen Nationalstaaten herrschten also jeweils Eliten, die viel miteinander gemein hatten – die roamische Sprache, die europäische Herkunft und den katholischen Glauben. Vor allem letzteren teilten sie mit der großen Masse der Beherrschten. In den neuen Nationalstaaten des östlichen Europas war das Bild deutlich anders – hier wurde die imperiale Elitedurch nationale Eliten abgelöst, die eine „indigene“, oft aus vorimperialer Zeit stammende Sprache sprachen, welche als Idiom des Volkes galt. Wer weiter auf dem Code des Imperiums, also auf dem Russischen, Osmanischen oder Deutschen bestand, hatte wenig Chancen, weiter zur Elite dazuzugehören, wurde vertrieben oder wählte die Emigration. Ähnliches galt für die Religion: Die neuen Staaten, sofern ihre Bevölkerung mehrheitlich christlich-orthodox war, beriefen sich jeweils auf eine Nationalkirche, different von der führenden Religion des ehemaligen Imperiums, aber auch von derjenigen der benachbarten Staaten. Sogar die eigentlich universale katholische Kirche und der national eher indifferente Islam versuchten mit der Zeit, das Modell der Nationalreligion nachzuahmen. Nur wer sich auch religiös zugehörig zeigte, konnte wirklich Teil der nationalen Elite werden. Dann wurde diese Elite, die in der Regel zu klein war, um einen Staat zu betreiben, systematisch um Menschen aus niederen sozialen Schichten erweitert, wodurch die soziale Distanz, wie sie noch im Imperium geherrscht hatte, geringer wurde. Getrieben von nationalen Mythen, die meist auf stolze vorimperiale Königreiche zurückgingen, machte sich diese Elite an die weitere Vergrößerung des nationalen Territoriums, wobei – wegen der vielen wechselseitig umstrittenen Gebiete – gewaltsame Konflikte zwischen den postimperialen Nationen unvermeidlich waren. Diese Auseinandersetzungen, die vor allem auf dem Balkan in vollwertige Kriege mündeten, waren dann die eigentliche Schule der Nationsbildung – sie ermöglichten die Vertreibung der national Anderen, machten einfache, noch nicht vom nationalen Gedankengut erfasste Männer zu Kombattanten, wodurch das ethnisch-nationale Freund-Feind-Denken vollends zum Massenphänomen wurde.
Lateinamerika ging hier einen ganz anderen Weg. Weder unterschieden sich die nationalen Eliten kategorial von jenen des Imperiums, noch unterschieden sie sich von Staat zu Staat. Weil das spanische Imperium im Wesentlichen friedlich entlang seiner inneren Verwaltungsgrenzen zerfallen war, gab es weniger territoriale Konflikte zwischen den Nachfolgestaaten. Nicht nur die Kultur, auch der Krieg fiel als Moment der Nationsbildung meistens aus.
Lateinamerika ging hier einen ganz anderen Weg. Weder unterschieden sich die nationalen Eliten kategorial von jenen des Imperiums, noch unterschieden sie sich von Staat zu Staat. Weil das spanische Imperium im Wesentlichen friedlich entlang seiner inneren Verwaltungsgrenzen zerfallen war, gab es weniger territoriale Konflikte zwischen den Nachfolgestaaten. Nicht nur die Kultur, auch der Krieg fiel als Moment der Nationsbildung meistens aus. Gerade in den Staaten mit großer indigener Bevölkerung war die „Nation“ ein großer Flickenteppich, geprägt von enormen sozialen wie auch kulturellen Unterschieden. Das nation building verlief ungleich langsamer und wurde in vielen Fällen nie abgeschlossen. Das wirkt paradox angesichts einer Elite, die durch ihren Ursprung und ihre Bildung normativ immer Teil der westlichen Geisteswelt sein wollte und sich damit auch Ideen wie Volkssouveränität, das allgemeine Wahlrecht oder die gleichberechtigte Staatsbürgerschaft zu eigen machte. Die Realität, in der diese Elite lebte, passte dazu aber kaum – viele Entwicklungsetappen europäischer Geschichte hatten in Lateinamerika nur in den Köpfen stattgefunden. Zu den oft nicht realisierten Normativa der europäischen Staatlichkeit gehörten unter anderem die Etablierung des staatlichen Gewaltmonopols und die Durchherrschung des Territoriums, der Aufbau eines flächendeckenden Schulwesens sowie vieles mehr.
Staatsferne Räume und Gesellschaftspolitik
Auch hier rächte sich, dass das maritime Imperium so stark auf wirtschaftliche Ausbeutung fixiert gewesen war. In wirtschaftlich als uninteressant angesehenen, bergigen oder von Regenwald bedeckten Gegenden fehlte eigentlich alles, was ein Nationalstaat zur Durchherrschung braucht – Straßen, Brücken, Schulen usw. Angesichts des enormen Sprengstoffs, der sich aus der sozialen Pyramide ergab, war das nicht ungefährlich – die lateinamerikanischen Nationalstaaten boten und bieten teilweise immer noch Rückzugsgebiete für alle, die mit der Ordnung nicht einverstanden sind oder die Staatlichkeit durch kriminelle Aktivitäten unterlaufen. Die Repräsentanten der staatlichen Ordnung trauen sich in vielen Ländern der Region entweder gar nicht in diese Gegenden oder aber suchen faule Kompromisse mit Strukturen, die nach dem Gesetz nur als kriminell bezeichnet werden können. Das Habsburger Reich und auch das Russische Reich hatten viel stärker darauf geachtet, solch staatsferne Räume möglichst klein zu halten, wobei ihnen auch das flachere Relief half. Am ehesten findet sich das Thema der mangelnden staatlichen Durchdringung in den Gebirgen des Balkans und des Kaukasus wieder, wo sich ganz ähnliche Rückzugsräume bildeten.
Aus dem bisher Gesagten lässt sich durchaus ein Teil der heutigen Realität Lateinamerikas und des östlichen Europas verstehen. Der Vergleich zeigt nämlich den großen „Erfolg“ des nationalen Denkens im östlichen Europa, wo der Nationalismus oft als eine Art Leit-Epistem funktioniert, das sich alle anderen Konzepte unterordnet. Ein gutes Beispiel dafür ist die Geschichte der (süd)osteuropäischen Agrarreformen, bei denen es vordergründig um die gerechtere Verteilung des Bodens ging, in die sich aber regelmäßig diskriminierende nationale Kriterien einschlichen, damit nur jene Bauern gefördert würden, die auch zur Titularnation gehören. Bei lateinamerikanischen Landreformen geht es dagegen darum, durch elementare Umverteilung von oben nach unten die unvollendete Nation überhaupt erst zu vollenden, also den Armen verschiedener Ethnien und Hautfarben Teilhabe zu gewähren – politisch, wirtschaftlich, sozial. Die Nation im Sinne der Französischen Revolution ist also hier ein klassisch linkes Thema, was für osteuropäische Ohren sicher ungewohnt klingt.
Schön, aber fest in der Regie von Paramilitärs: Teile der kolumbianischen Kaffeezone, © Klaus Buchenau
Die Rechte im östlichen Europa hat mit alldem wenig zu tun und ist ein weitaus komplexeres, „tieferes“ Phänomen, ohne deswegen politisch mächtiger zu sein.
Auch „rechts“ zu sein bedeutet im östlichen Europa und in Lateinamerika keineswegs dasselbe. Die lateinamerikanische Rechte schützt vor allem die bestehende Gesellschaftspyramide, die Privilegien der Oberschicht. Sie hat eine Affinität zum liberalen Denken, sofern es um bestehende Eigentumsrechte geht; dies wiederum ermöglichte auch die Achsenbildung mit Washington, also den gemeinsamen Kampf gegen vermeintliche oder tatsächliche „kommunistische“ Kräfte, deren Machtübernahme bis in die 1980er Jahre mit allen Kräften verhindert werden sollte, und sei es durch Militärputsche, die Gründung paramilitärischer Gruppen und ähnliches. Die Rechte im östlichen Europa hat mit alldem wenig zu tun und ist ein weitaus komplexeres, „tieferes“ Phänomen, ohne deswegen politisch mächtiger zu sein. Der Gedanke, „rechts“ sei das Predigen einer komplexen Sozialpyramide und der Respekt vor dem jeweils Ranghöheren, ist rechten Politikern wie Viktor Orbán ziemlich fremd. Sie sehen sich als Anführer einer kompakten, einzigartigen Nation, welche sie unter Zuhilfenahme der nationalen Souveränität vor äußeren Attacken schützen wollen. Diese „Rechten“ sehen sich nicht als aristokratische Schicht, sondern als Fürsprecher von Underdogs, die von globalen Eliten attackiert werden. Das philosophische Arsenal, auf das sie Bezug nehmen, ist weitaus komplexer als jenes, das die lateinamerikanischen Rechten auffahren – in der osteuropäischen Rechten findet sich viel mehr als die pure Klassenpolitik, die auf der lateinamerikanischen Rechten verbreitet ist und sich dort als Europäismus tarnt. Die Rechte im östlichen Europa kombiniert vielmehr religiöse Lehren aus den jeweiligen “Nationalkirchen” mit romantischer Philosophie, Ideen von Advokaten des französischen Ancien Régime, Anleihen an die deutsche konservative Revolution, ein Schuss eugenisches Denken, moderne Kapitalismuskritik, nivellierende Vorstellungen von der „Volksgemeinschaft“ und vieles mehr.
Hinter diesen Unterschieden standen auch unterschiedliche Grundlogiken – während die Expansion der Kontinentalreiche oft durch das Streben nach einer militärisch gut absicherbaren Grenze angetrieben wurde, waren die spanischen und portugiesischen Eroberungen stark von merkantilen Logiken motiviert. Letzere brachten die Conquistadoren dazu, fremdstämmige Bevölkerungen zu versklaven; das kam auch in Kontinentalreichen vor, hier allerdings konterkariert durch den Aufbau militärischer Allianzen, woraus sich Aufstiegschancen für die Kolonisierten ergaben. Zwar gibt es Anzeichen, dass diese Unterschiede durch globale Ideenzirkulation etwas abschleifen, wie es sich etwa in der Rezeption des antiwestlichen deutschen Philosophen Oswald Spengler in beiden Regionen andeutet. Ganz verschwinden wird die Differenz aber kaum, angesichts der unterschiedlichen sozialen Realitäten im östlichen Europa und in Lateinamerika.
Damit ist indirekt auch schon das Wichtigste über den Gegenpart angedeutet – die Linke in beiden Regionen. In Lateinamerika sind die Linken mächtige und prinzipielle Gegenspieler der Rechten, d. h. sie sind diejenigen, welche die aus kolonialer Zeit ererbte Sozialpyramide angreifen und – je nach Radikalität – auf die Enteignung und Vertreibung der traditionellen Eliten oder aber auf eine graduelle Umverteilung von Reichtümern hinauswollen. Die radikalere Gangart wird dabei von den „russischen Klienten” Kuba, Nicaragua und Venezuela repräsentiert, die weichere von den gegenwärtigen Regierungen in Kolumbien, Chile, Brasilien und Mexiko. Wenn die Linke in Wahlen erfolgreich ist, was in diesem Millennium, nach dem Ende der rechten Militärdiktaturen und der Enttäuschung der Wählerinnen und Wähler mit neoliberalen Versuchen, häufiger der Fall ist, so arbeiten sie intensiv an dieser Agenda. Oft verfahren sie dabei populistisch und autoritär; diejenigen unter ihnen, die sich auf die kommunistische Tradition berufen, gehen besonders weit in der Aushöhlung bürgerlicher Freiheiten und auch in der Konfrontation mit den Vereinigten Staaten. Während die Rechten diese Konfrontation als Katastrophe für die Wirtschaft und für das eigene Geschäft ansehen, sieht das die radikale Linke, und Teile der Gesellschaft mit ihr, nicht als Problem an, weil die USA diskursiv mittlerweile in die Rolle des kolonialen Spanien gerückt sind, also als das neue ausbeuterische Imperium gelten.
Mexikos Gesellschaftspyramide mit Trotzki als Retter – Wandgemälde von Diego Rivera, © Klaus Buchenau
Die Präsenz der Linken im östlichen Europa und ihre historischen Wurzeln
Im östlichen Europa, so könnte man sagen, gibt es eigentlich gar keine einflussreiche Linke im oben beschriebenen, redistributiven Sinne – zumindest nicht seit dem Ende des Staatssozialismus. Die Parteien, die sich im postsozialistischen Europa „sozialdemokratisch“ nennen und historisch meistens auf die gestürzten Kommunisten zurückgehen, haben sich als die eigentlichen Steigbügelhalter des Neoliberalismus erwiesen, als diejenigen, die weitaus glatter und professioneller als die neuen, im Gründungsimpuls antikommunistischen Parteien die Westintegration vorangetrieben haben, wobei sie alle negativen Begleiterscheinungen akzeptierten: darunter die hohe Arbeitslosigkeit, den Niedergang von Industrien, die Not der Privathaushalte. Sicher, sie konnten auch manche Lorbeeren einfahren, insbesondere die EU-Integration und damir den Zugang zum europäischen (Arbeits-)Markt sowie Transfers aus Brüssel. Diese Verdienste haben aber mit linker Programmatik wenig zu tun, den „Job” hätten ebenso liberale oder konservative Parteien leisten können, wenn sie denn über entsprechend „geschmeidiges“ und mit allen Machttechniken vertrautes Personal verfügt hätten. Es stellt sich die Frage, ob dieses Phänomen „linker Absenz“ nur mit der Erfahrung des kommunistischen Systems zu erklären ist. Sicher, es macht einen Unterschied, ob jemand mit dem Realsozialismus stundenlanges Anstehen nach Wurst und Wodka assoziiert, oder aber – wie mitunter die lateinamerikanische Linke – eine romantisierende Fernbeziehung mit der Sowjetunion führte, die man von innen nie kannte; oder mit Kuba, das man ebenfalls nicht aus eigener Anschauung kennt, aber als ewiges Opfer des US-Imperialismus verteidigt.
In Lateinamerika lässt sich der antiimperialistische wie auch der antikapitalistische Diskurs, als Gegenentwurf zur real bestehenden, oligarchischen Ordnung, bis tief ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Dieser soziale Diskurs hat im östlichen Europa keine direkte Entsprechung, […].
In historischer Perspektive scheint es, dass der Faktor „Erfahrung mit dem Realsozialismus“ als Erklärung zu kurz greift. In Lateinamerika lässt sich der antiimperialistische wie auch der antikapitalistische Diskurs, als Gegenentwurf zur real bestehenden, oligarchischen Ordnung, bis tief ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Dieser soziale Diskurs hat im östlichen Europa keine direkte Entsprechung, hier dominiert schon im 19. Jahrhundert die Tendenz, gesellschaftliche Konflikte ethnisch-national zu begreifen; dieser Unterschied hängt ganz offensichtlich zusammen mit den oben erwähnten Unterschieden zwischen den Kolonialreichen und dem Erbe, das sie hinterließen.
Nationalkommunistische Familienmetaphorik: Nicolae und Elena Ceauşescu als Eltern der rumänischen Nation (pinterest), Source: pinterest
Natürlich war soziale Ungerechtigkeit auch im östlichen Europa als Thema immer präsent, allerdings fällt auf, dass viele Akteure und Denker der Linken (tatsächlich ganz überwiegend Männer) im Laufe der Zeit ihre Kompromisse mit dem Nationalen schlossen, um schließlich ganz und gar national zu werden. Das gilt für einen großen Teil der nicht marxistischen Linken, insbesondere für die Bauernpolitiker der Region, die sich im Zuge ihrer politischen Etablierung in nationale Bourgeoisien und in Verfechter nationalistischer Programme verwandelten. Es gilt aber auch für die Kommunisten selbst, die zunächst im Mutterland der Revolution, der Sowjetunion, massiv mit nationalen Angeboten (korenizacija, Föderalisierung) um die national motivierten Gegner des Imperiums warben, danach des „Kosmopolitismus“ und der Weltrevolution entsagten und schließlich im Zweiten Weltkrieg vollends die traditionell-patriotische Karte spielten. Nach 1945 schließlich versuchen die Kommunisten überall in den Satellitenstaaten der Sowjetunion, sich als Vollender des nationalen Projekts darzustellen und auf diese Weise ihr Legitimitätsdefizit auszugleichen. In etlichen Fällen (Albanien, Mazedonien, Zentralasien) rührt die Legitimation der Kommunisten maßgeblich daher, dass sie tatsächlich diejenigen waren, die das nation building vollendeten bzw. überhaupt erst anstießen. Und das auf breitester Front: sprachlich durch die Etablierung von Nationalsprachen, institutionell durch die herrschaftliche Durchdringung, ideologisch durch die Propagierung eines einheitlichen Geschichtsbildes über das mancherorts erst nach 1945 ausgebaute Schulwesen. In ideologisch besonders pikanten Fällen schufen die an sich religionsfeindlichen Kommunisten sogar eigene orthodoxe Kirchen bzw. brachten deren Entwicklung voran, wie die Gründung der Tschechoslowakischen Orthodoxen Kirche, der Mazedonischen Orthodoxen Kirche oder auch die Autokephalie der Bulgarischen Orthodoxen Kirche zeigt. All dies waren „nationale“ Werke, die ohne die Hilfe kommunistischer Parteien unmöglich gewesen wären, und die sich geradezu ideal in das Muster des osteuropäischen Ethnonationalismus einfügten.
Wenn überhaupt, dann waren also selbst die Kommunisten Osteuropas nur in einem sehr eingeschränkten Sinne „links”. Die heutigen ideologischen Landschaften spiegeln das gut wieder – der sogenannte „Rechtspopulismus“ hängt stark mit der Kommunismusnostalgie zusammen und kann auf dessen Betonung von Sicherheit, Gleichheit und nationaler Homogenität aufbauen. Aber auch liberale pro-europäische Parteien können leicht auf kommunistisches Erbe zurückgreifen – insbesondere auf reformmarxistische Ansätze, auf ein gewisses Freidenkertum, das sich seit den 1960er Jahren in der kommunistischen Nomenklatur breitmachte; am stärksten aber auf einen tief eingeübten Pragmatismus, der in der kommunistischen Parteimitgliedschaft eine Voraussetzung zum Karrieremachen sah und Ideologie grundsätzlich als Lippenbekenntnis betrachtete. Auf den osteuropäischen Kommunismus lässt sich offenbar alles, nur kein echt linkes Denken zurückführen (solches findet man in der Region am ehesten dort, wo es nie einen Realsozialismus gegeben hat: in Griechenland).
Im Vergleich dazu wirkt die lateinamerikanische Linke überaus frisch, weil sie, anders als die Rechte, die direkte Bearbeitung der schwersten postimperialen Hinterlassenschaft verspricht: der steilen Gesellschaftspyramide. Wie vital dieses Denken ist, sieht man vor allem daran, dass auch historische Rückschläge nicht dazu führen, linkes Denken nachhaltig zu diskreditieren.
Im Vergleich dazu wirkt die lateinamerikanische Linke überaus frisch, weil sie, anders als die Rechte, die direkte Bearbeitung der schwersten postimperialen Hinterlassenschaft verspricht: der steilen Gesellschaftspyramide. Wie vital dieses Denken ist, sieht man vor allem daran, dass auch historische Rückschläge nicht dazu führen, linkes Denken nachhaltig zu diskreditieren. Verziehen wird eigentlich alles: dass das kubanische Modell seine Schattenseiten und ohnehin seine besten Zeiten hinter sich hat; dass Nicaragua sich nach der Rückkehr der Sandinisten an die Macht in eine reaktionäre Autokratie verwandelt hat; dass aus dem venezolanischen „Modell“ Armut und Massenflucht geworden sind; dass die autoritäre Wende der linken Präsidenten Evo Morales in Bolivien oder Rafael Correa in Equador nur durch deren Sturz beendet werden konnte – das alles kann dem Wahlerfolg linker Politiker offenbar nur wenig anhaben, wie etwa die Wahlsiege von Andrés Manuel López Obrador in Mexiko, Lula da Silva in Brasilien, Gustavo Petro in Kolumbien oder Gabriel Boric in Chile seit 2022 zeigen.
Die Universität Medellín in Kriegsbemalung: Der Maoismus des „Leuchtenden Pfades“ soll es richten, © Klaus Buchenau
Ich habe hier nur einige Aspekte herausgegriffen, die sich aus einer wechselseitigen Spiegelung des östlichen Europa und Lateinamerikas ergeben. Als Forschungsfeld hat der Vergleich der Regionen, aber auch die Verflechtung der Regionen, noch weitaus größeres Potential. Manche der hier skizzierten Grundannahmen könnten durch systematische, auf Fallstudien eingegrenzte Forschungen überprüft werden: So etwa die Hypothese, dass Identitäten im östlichen Europa ethnisiert und „religionisiert“ sind, in Lateinamerika dagegen eher entlang sozialer Kriterien bestimmt sind – vielleicht habe ich überzogen und ein Detailvergleich käme zu nuancierten Ergebnissen? Lohnend wären auch Forschungen über das historische Gedächtnis in beiden Regionen, um die hier formulierte Hypothese des kompakten ethnisch-nationalen Geschichtsnarrativs im östlichen Europa und des sozialen „Zerrissenheitsnarrativs“ in Lateinamerika zu überprüfen. Möglich wäre auch ein vergleichender Blick darauf, wie Identitäten und Gedächtnisse in konkrete Politiken übersetzt werden, etwa im Bereich der regionalen Integration. Wenn es stimmt, dass sich die osteuropäischen Ethnonationen nicht nur als postimperial, sondern gleichzeitig auch gegeneinander definierten, wogegen die lateinamerikanischen Nationalstaaten viel stärker auf (pseudo)imperiale Gegenüber fixiert sind, dann müsste sich daraus ergeben, dass regionale Integration in Lateinamerika von innen heraus „gegen den äußeren feind“ stattfinden kann. Dagegen muss im östlichen Europa vor allem von außen angeleitet werden, weil das wechselseitige Misstrauen in der Region anderes oft verhindert. Wer das südamerikanische Integrationsprojekt Mercosur mit der EU-Erweiterung vergleicht, scheint dieses Grundmuster auch in der Realität wiederzufinden.
Eine religionisierte Wahl zwischen West und Ost, Böse und Gut: Die Ukraine von 2014 aus russisch-antiwestlicher Sicht, © Klaus Buchenau
(In)formale Strukturen
Ein weiteres fruchtbares Forschungsfeld wäre jenes der (In)Formalität. Wenn beide Regionen auch aufgrund ihrer imperialen Erfahrung Gesellschaften öffentlichen Misstrauens geworden sind, in denen man tendenziell davon ausgeht, dass der Staat einem schaden will, so hilft das zu erklären, weshalb Regeln großzügig gebrochen werden. Dabei scheinen sich die Hinterlassenschaften des Osmanischen Reiches und des Spanischen Kolonialreichs durchaus zu ähneln. Allerdings ist es möglich, historisch ausgetrampelte Pfade auch wieder zu verlassen – etwa, wenn Institutionen im Zuge eines EU-Beitritts intensiv beobachtet und umgestaltet werden. Seit den 2000er Jahren wurden im östlichen Europa bestimmte Typen von Alltagskorruption extrem zurückgedrängt, etwa im Bereich der Polizei. In Lateinamerika, wo es den Impuls eines EU-Beitritts nie gab und regionale Integration sich vornehmlich auf Handelspolitik beschränkte, scheint es derartig radikale Veränderungen nicht gegeben zu haben – oder doch?
Lohnend ist schließlich ein Blick auf die Episteme, welche Area Studies innerhalb beider Regionen beherrschen. In Lateinamerika wie im östlichen Europa ist die „Selbsterklärung“ stark von den akademischen Zentren außerhalb der Region geprägt, d. h. im Wissensbereich gibt es nach wie vor imperiale Strukturen, die von Westeuropa bzw. den USA an die beforschten Peripherien ausgreifen und die akademische Selbstdeutung beeinflussen. Allerdings: Im östlichen Europa erwächst – aufgrund einer historisch starken Rechten mit entsprechender intellektueller Tradition – den meist liberal dominierten Epistemen aus dem Zentrum eine mächtige Konkurrenz, die sich zum Beispiel in der Gründung konservativer Think Tanks in Russland, Ungarn, Polen oder Serbien ausdrückt. In Lateinamerika scheint dergleichen nicht in Sicht, was mit der relativen Stärke der Linken und der oben beschriebenen, spärlichen intellektuellen Ausstattung der Rechten zusammenhängt.
Lehren aus Lateinamerika: Eine Perspektive auf Diversität, Vertrauen und soziale Anomie für das heutige Europa
Ich möchte abschließen mit einer Frage, die v. a. für das Europa von heute relevant ist, nicht nur für das östliche: Was können wir eigentlich von Lateinamerika lernen, im positiven Sinne? Von den kolossalen Schwierigkeiten, die einige Staaten und Gesellschaften der Region haben, war ja bereits die Rede. Dennoch oder gerade deswegen scheint es mir ein erhebliches Lernpotential für uns zu geben. In den vorangegangenen Passagen war viel die Rede von der Dominanz nationalen, ethnischen Denkens im östlichen Europa. Wenn wir uns die Gesellschaften des heutigen Westeuropa ansehen, ist allerdings offensichtlich, dass auch hier nationale Homogenität mittlerweile eine bedeutende Rolle im Diskurs spielt – Teile unserer Gesellschaft haben offensichtlich Angst, die historisch etablierte Homogenität aufgrund von Migration wieder zu verlieren, sich gar „selbst abzuschaffen“. Tatsächlich sind unsere Vorstellungen von öffentlichem Vertrauen, eigentlich ein „Stolz“ des Westens, zumindest indirekt an Homogenitätsvorstellungen geknüpft – wir verlassen uns auf Regeln, die wir vereinbart haben, weil wir davon ausgehen, dass auch die anderen so ähnlich sind wie wir und die Befolgung dieser Regeln deshalb für genauso selbstverständlich halten. Wenn ich Unbekannten vertraue, dann deshalb, weil ich davon ausgehe, dass sie ungefähr so „ticken“ wie ich. Der Transfer dieses aus relativ „homogener Zeit“ stammenden öffentlichen Vertrauens in einen neuen, ethnisch wie weltanschaulich diverseren Kontext ist unseren Gesellschaften als Ganzes bislang nicht gelungen. Es gibt zweifellos Biotope eines bewussten, gelebten und funktionierenden Multikulturalismus; aber ganz unübersehbar gibt es auch die Kombination von massiver Migration, ethnischer Separation und wechselseitigem Misstrauens zwischen verschiedenen Gruppen einer Einwanderungsgesellschaft, in der jede Gruppe sich vor allem an ihre eigenen Regeln hält und die Gültigkeit des alle verbindenden Regelwerks infrage stellt.
Hochmoderne Drahtseilbahn schwebt über Armutsviertel hinweg: Medellín, © Klaus Buchenau
Die wichtigste Botschaft, die diese Länder aussenden, kann auch optimistisch verstanden werden: Vom Verlust der Homogenität geht die Welt nicht unter, man kann damit leben, und das jahrhundertelang.
Lateinamerika hat diesen Sprung in die Diversität, aber auch in die soziale Anomie schon längst hinter sich – seit der spanischen bzw. portugiesischen Eroberung wurde hier meist ein Nebeneinander der ganz Verschiedenen praktiziert. Ein öffentliches Vertrauen, wie es Westeuropas Gesellschaften bis in die 1990er Jahre kannten, ist hier unbekannt. Allerdings, und das ist der Vorteil, gibt es in Lateinamerika weniger Probleme für von außen Kommende, einen Platz in der Gesellschaft zu finden – wo es keine „Leitkultur“ gibt, kann man auch nicht an ihr scheitern. Die wichtigste Botschaft, die diese Länder aussenden, kann auch optimistisch verstanden werden: Vom Verlust der Homogenität geht die Welt nicht unter, man kann damit leben, und das jahrhundertelang. Die chronische soziale Ungerechtigkeit, die hier wie auch in unserer westeuropäischen Migrationsgesellschaft oft ethnisiert ist, bleibt allerdings ein Ansporn, den Wert der universalen Menschenwürde nicht zu vergessen.
© 2023. This text is openly licensed via CC BY-NC-ND. Separate copyright details are provided with each image. The images are not subject to a CC licence.