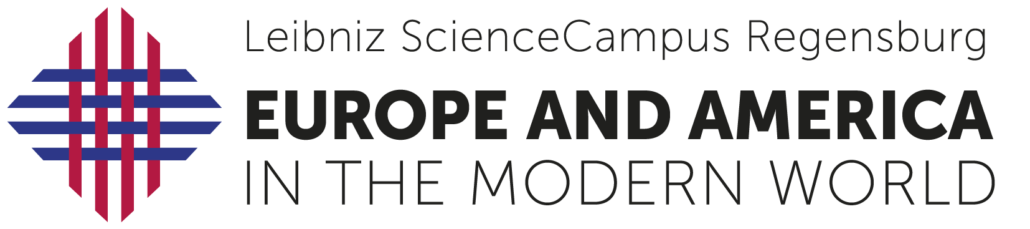In an insightful essay, Natali Stegmann – associate professor of East European History at UR and co-coordinator of the ScienceCampus Research Module Towards Multi-Polar and Multi-Scalar Area Studies – analyses the long-term traditions of social policy in Central and Eastern Europe. Using the Polish trade union Solidarność (Solidarity) as her central case study, she argues that the transformations of social policy and labour relations at the end of the Cold War overlooked established ideas, including those that formed continuities between earlier decades of the twentieth century and the state-socialist period. This ultimately had a negative impact on gender relations with the labour market. This occurred, she shows, for two reasons; firstly, because of the adoption of neoliberal, Chicago School-inspired models for transformation; secondly, because of a misunderstanding of apparently “national” traditions of social and labour policy that meant progressive ideas that seemed to be inflected with “socialism” but were actually reflective of international and transnational ideas were cast aside.
The essay is in German.
International Labour Organization offices, Geneva, Switzerland; picture credit © IMAGO / agefotostock
Generate PDF
Der Wohlfahrtsstaat wird gemeinhin als eine historisch gewachsene nationale Institution verstanden. Sowohl internationale als auch europäische Solidaritätsoptionen scheinen daher politisch schwer vermittelbar.[1] Dieser Essay möchte aufzeigen, dass eine solche Verengung der Wahrnehmung auf nationale Solidargemeinschaften zu kurz greift, auch da sie die Bedeutung der Systemtransformationen von 1989/90 verkennt.[2] Im Folgenden werden in diesem Sinne drei Gedankenstränge zusammengeführt. Der Essay stellt erstens Traditionen europäischer Sozialpolitik seit dem Ende des 19. Jahrhunderts dar. Als historischer Orte dieser im Grundsatz persistenten Traditionen fokussiert er auf die Habsburgermonarchie einerseits und auf Internationale Organisationen andererseits. Die Habsburgermonarchie erstreckte sich über weite Teile des europäischen und insbesondere des ostmittel- und südosteuropäischen Raums; mit deren Zusammenbruch wurden diese nach dem Ersten Weltkrieg grundlegend für die Ausgestaltung sowohl nationaler als internationaler Sozialpolitiken; der Charakter der fraglichen Nationalstaaten wie auch der Internationalen Organisationen in der Zwischenkriegszeit lässt – wie zu zeigen sein wird – die Schlussfolgerung zu, es habe sich hierbei um europäische Traditionen gehandelt; europäische Traditionen, die eben bei der Gründung und den Erweiterungen der EU im Kontext des Kalten Krieges unberücksichtigt blieben (weswegen die EU nicht als Ort europäischer sozialpolitischer Traditionen gelten kann).
In diesem Sinne wird zweitens die These entwickelt, dass die dargelegten trans- und internationalen Traditionen unter dem Einfluss des sogenannten Neoliberalismus insbesondere seit dem Ende des Kalten Krieges durch nationales Denken überlagert worden sind. Es wird also unterstellt, dass Sozialpolitiken keineswegs von vornherein allein national codiert waren, sondern dass diese vor allem in der Abwendung von (auch während des Kalten Krieges) gemeinsamen europäischen Traditionen insbesondere in den post-sozialistischen Ländern eine scharf ausgrenzende nationale Komponente erhielten. Drittens wird diese keineswegs zwangsläufige Wendung mit Blick auf den zugrunde gelegten Stellenwert von Arbeit näher beleuchtet. Das Augenmerk richtet sich dabei nicht zuletzt auf Geschlechternormen als Stellschrauben im Prozess ökonomischer und politischer Transformation. Das Argument wird anhand der International Labour Organisation (ILO) und insbesondere hinsichtlich der Bedeutungsverschiebungen in den Auseinandersetzungen um die unabhängige (polnische) Gewerkschaft Solidarność entwickelt.
doi number
10.15457/frictions/0019
Methodische Vorannahmen: Sozialpolitiken?
Sowohl in den politischen Debatten als auch in der Forschung erscheint der Nationalstaat zumeist als institutioneller Bezugsrahmen von Sozialpolitiken und die nationale Gemeinschaft oder die Gemeinschaft der Staatsbürger als die Gruppe, auf die sich entsprechende Solidaritätsoptionen richten. Sozialpolitik wird zudem häufig in eins gesetzt mit dem Sozialversicherungswesen, und hier wird im Verlauf des 20. Jahrhunderts ein kontinuierlicher Ausbau angenommen. Ist dies aber nicht zu kurz gedacht? Ich möchte im Folgenden argumentieren, dass Sozialpolitiken historisch nicht nur im Nationalen verankert sind; sie hatten vielmehr seit der zunehmenden Implementierung sozialer Rechte am Ende des 19. Jahrhunderts im oben genannten Sinne eine wesentliche europäische Komponente. Zudem orientieren sich Sozialpolitiken stark an der Familie und zementieren daher zugleich Geschlechternormen, dies betrifft die europäischen (nationalen, trans- und internationalen) Traditionen wie auch den Übergang zum Post-Sozialismus. In Erweiterung der Wohlfahrtsstaatsforschung haben auch die Gender-Studies herausgestellt, dass und wie – über das Sozialversicherungswesen hinaus – Familien- und Bildungspolitik, Eigentumsordnungen und der Zugang zum Arbeitsmarkt zentral für die soziale Stellung des Einzelnen sowie von zusammenlebenden Menschen und mithin von Familien sind.[3] In diesem Sinne wird hier der Begriff der Sozialpolitik im Plural verwendet; gemeint sind damit weniger die Ausgestaltung von Sozialpolitik in den unterschiedlichen politischen Regimes als vielmehr die unterschiedlichen Felder von Sozialpolitik und deren Zusammenhänge unter einem jeden Regime.
Die Wohlfahrtsstaatsforschung[4] hat bislang weder die sozialistischen noch die postsozialistischen Regimes systematisch in ihre Analyse einbezogen, obgleich gerade dies viel zum Verständnis der gegenwärtigen Friktionen beitragen würde.[5] Die Frage nach nationalen oder supranationalen Solidaritätsoptionen kann nämlich – so das grundlegende Argument – nicht hinreichend verstanden werden, wenn nicht zugleich das spezifische post-sozialistische Paradigma einer freien Marktwirtschaft mitreflektiert wird (also einer Vorstellung von freier Marktwirtschaft, die keineswegs originär, sondern zeitspezifisch war).
Traditionen europäischer Sozialpolitiken
Sozialpolitiken waren im 20. Jahrhundert in der Nation und in den supra- und internationalen (wie auch in den europäischen) Institutionen in dreifacher Hinsicht verortet, nämlich erstens unter dem Begriff der sozialen Rechte als Element der Staatsbürgerschaft, zweitens seit dem Ende des Ersten Weltkriegs unter dem Begriff der sozialen Gerechtigkeit als Voraussetzung für den Frieden, sowie drittens unter dem Begriff der sozialen Sicherheit als Menschenrecht.
In allen drei Dimensionen haben Sozialpolitiken eine supranationale Komponente, deren Überhang bis in unsere Tage von Bedeutung ist. Wenn wir nämlich auf heutige sozialpolitische Institutionen aus der Perspektive ihrer Entstehungsgeschichte schauen, so sind deren Bedingungen keineswegs eindeutig national.[6] Insbesondere in der Habsburgermonarchie sind sozialpolitische Institutionen schon vor der Gründung ihrer national verfassten Nachfolgestaaten implementiert worden (sie waren demnach zuerst transnational). Noch vor dem Ersten Weltkrieg wurden dort Gesundheits-, Unfall und Invaliditätsversicherungen zunächst für den voll beschäftigen Arbeiter eingeführt, also für den männlichen Familienernährer (als Norm). Dieses System wurde in den Nachfolgestaaten übernommen und ausgebaut. Die Gesetzgebung des vormaligen Regimes galt als modern und vorbildlich und wurde daher in den neuen nationalen Rahmen eingefasst. [7] Dieses institutionelle Erbe überdauerte in seiner Substanz häufig die politischen Systemwechsel; was sich dagegen mit den Regimewechseln änderte, waren die zugrunde gelegten Aus- und Einschlussmechanismen.[8]
Vor und besonders nach dem Ersten Weltkrieg gab es in den europäischen Ländern ähnliche Problemlagen, die sich wesentlich aus dem wirtschaftlichen Wandel und aus dem Krieg ergaben. Mit der Industrialisierung war eine Arbeiterschaft entstanden. Binnenmigration und Verstädterung führten zur Auflösung traditioneller Fürsorgestrukturen. Die Arbeiterschaft war von Verarmung bedroht und zugleich gut organisiert. Der Erste Weltkrieg verschärfte die Probleme. Millionen Männer kehrten oftmals schwer verwundet von den Schlachtfeldern zurück und suchten nach Auskommen.[9] Vor diesem Hintergrund war es offenbar nicht nur die Zeitgemäßheit der sozialpolitischen Institutionen, die in den nun entstandenen Nationalstaaten zu deren Übernahme führte (inklusive der Geschlechternormen).[10] Vielmehr müssen wir über die Systemumbrüche von einer Kontinuität der Institutionen und der Akteure ausgehen, und – was noch wichtiger scheint – auch von einer Kontinuität staatlicher Legitimationsstrategien. Damit korrespondierten die sozialpolitischen Erwartungen der Bürger.[11] Denn die Implementierung sozialer Rechte bewirkte in der Tendenz bei den Bürgern Erwartungen an jedwedes neue Regime, und diese Erwartung wurde mit der Verschärfung der Probleme dringender. Diese Beobachtung gilt umso mehr, als dass im Sinne der Versailler Ordnung in den fraglichen Staaten zahlreiche Bürger nunmehr als Angehörige nationaler Minderheiten galten, die sich oftmals nur schwer in die neue Ordnung einfügten.[12] Die veränderungsträgen sozialpolitischen Institutionen trugen nun auch zu deren Integration bei, solange ein Mindestmaß an sozialen Standards gewährt werden konnte. Die Erwartungen der Bürger (und in anderer Weise der Bürgerinnen) waren somit nicht vorrangig an die Nation, sondern an den Staat gerichtet; sie konnten somit zur Legitimierung der neuen Ordnung entscheidend beitragen.[13]
Dass der Staat für seine Bürger zu sorgen habe, blieb auch nach dem Zweiten Weltkrieg ein grundlegendes Element der neuen Ordnung. Die Tatsache, dass auf dem Gebiet der ehemaligen Habsburgermonarchie und ihrer Nachfolgestaaten nun sozialistische Volksrepubliken entstanden, gibt bei genauem Hinsehen nicht ausreichend Anlass zu der Schlussfolgerung, diese Volksrepubliken hätten nicht in der Tradition europäischen Denkens und überkommener sozialpolitischer Institutionen im hier beschriebenen Sinne gestanden. Auch waren die so genannten Ostblockstaaten keineswegs abgeschnitten von den allgemeinen Entwicklungen in Europa und der Welt. [14] Es lassen sich vielmehr zahlreiche Kongruenzen, Wechsel- und Austauschbeziehungen feststellen, gerade auf dem Feld der Wirtschafts- uns Sozialpolitik.[15] Zugleich führten Gewalt und insbesondere der Genozid an den europäischen Juden und die Bevölkerungstransfers am Ende des Zweiten Weltkrieges in der Region zu nationalen Homogenisierungen.[16] Der Regimewechsel zum Sozialismus ging zudem mit einer Umorientierung weg vom männlichen Familienernährer, hin zu Staatspaternalismus und zu einer weitrechenden Arbeitspflicht unter Einbeziehung der Frauen einher.[17] Nationale Homogenisierung und die Abkehr von der Vorstellung, es sei hauptsächlich der Mann für den Familienunterhalt verantwortlich, fielen so in eins. Soziale Erwartungen bleiben also erhalten; ideologisch waren der Arbeiter (und nachgeordnet die Arbeiterin) sogar wichtiger als vorher, aber die Funktion der Ehe und der Familie für die soziale Versorgung des Einzelnen wurden zurückgenommen.
Für die spätsozialistischen Staaten waren schließlich sowohl das Versprechen auf Sicherheit und Wohlstand als auch nationale Solidaritätsoptionen von wesentlicher Bedeutung. Trotz Planwirtschaft, Arbeitsrecht und Arbeitspflicht sowie Staatspaternalismus als Merkmalen sozialistischer Wohlfahrtsstaatlichkeit bestanden die Erwartungshaltungen und auch entsprechenden Institutionen fort, während zugleich die Geschlechterordnung wesentlichen Veränderungen unterworfen wurde. Gerade gegen die so genannte Emanzipation von oben positionierten sich die gesellschaftlichen Gegenbewegungen zusehends, während gleichzeitig die Bezugnahme auf das Nationale verfestigt wurde. Wenn nach dem Ende des Sozialismus sozialpolitische Erwartungen aufrechterhalten blieben, so konnten diese also leicht national ausgedeutet und zugleich eine Rückkehr zu vorherigen Rollenmustern eingefordert werden. Im Kontext von De-Industrialisierung und Arbeitslosigkeit führt dies zur Verunsicherung gerade hinsichtlich der sozialen Identität des männlichen Arbeiters und Familienernährers. Soziale Rechte werden so häufig aggressiv eingefordert und nach außen verteidigt.
Trans- und internationale Dimensionen
Mit Blick auf Systembrüche und Gewalterfahrungen haben Sozialpolitiken – neben dem Habsburger Erbe – eine grundlegende internationale Dimension. Internationale Organisationen stehen zugleich auch für die historische Kontinuität eines progressiven Europas; im Entstehungskontext dieser Institutionen schlug sich nicht zuletzt das Modell habsburgischer bzw. vermeintlich „deutscher“ Sozialpolitiken nieder.[18]
Der Versailler Vertrag etablierte nicht nur eine neue territoriale Ordnung, sondern mit dem Völkerbund auch eine supranationale (in der Zwischenkriegszeit stark europäisch geprägte bzw. dominierte) Organisation, die dem Friedenserhalt diesen sollte. Obwohl dies zunächst nicht gelungen ist, wird die Qualität der Versailler Ordnung in der neueren Forschung insbesondere auch hinsichtlich ihrer internationalen Institutionen höher eingeschätzt als dies früher der Fall war. Im Völkerbund scheinen demnach die Ansätze eines dauerhaften friedlichen Zusammenlebens angelegt, da diese Vorläuferorganisation der Vereinten Nationen auch für die internationale Zusammenarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg grundlegend war. [19] Die Architekten der Versailler Ordnung hatten eine genaue Vorstellung von der hohen Bedeutung des Sozialen für den Friedenserhalt und schufen daher mit der ILO eine arbeits- und sozialpolitische Institution, die nicht in Konkurrenz zu nationalen Institutionen stand, sondern diese zusammenführte. Der Zusammenhang zwischen sozialer Gerechtigkeit und Friedenserhalt ist im Vertrag klar formuliert. Die Etablierung der ILO wird nämlich wie folgt begründet (Teil VIII, Arbeit; Abschnitt I: Organisation der Arbeit):
Da der Völkerbund die Begründung des Weltfriedens zum Ziele hat, und ein solcher Friede nur auf dem Boden der sozialen Gerechtigkeit aufgebaut werden kann, da ferner Arbeitsbedingungen bestehen, die für eine große Anzahl von Menschen mit so viel Ungerechtigkeit, Elend und Entbehrungen verbunden sind, daß eine den Weltfrieden und die Welteintracht gefährdende Unzufriedenheit entsteht, und da eine Verbesserung dieser Bedingungen dringend erforderlich ist, […] da endlich die Nichtannahme einer wirklich menschlichen Arbeitsordnung durch irgendeine Regierung die Bemühungen der anderen […] hemmt, haben die H o h e n v e r t r a g s c h l i e ß e n d e n T e i l e, geleitet sowohl von den Gefühlen der Gerechtigkeit und Menschlichkeit als auch von dem Wunsche, einen dauernden Weltfrieden zu sichern, […] [dieses] vereinbart […].[20]
Der Vertrag intendierte mithin die Durchsetzung internationaler Standards im Arbeitsschutz und bei den Arbeiterrechten in der Überzeugung, dass die Minderung von sozialer Unzufriedenheit eine umfassende Aufgabe sei, deren Umsetzung zur „Welteintracht“ beitragen und damit neue Kriege verhindern helfen würde. Gerechtigkeit und Menschlichkeit wurden hier als eine Dimension des Sozialen aufgefasst, und nicht, wie dies zunehmend seit 1989/90 der Fall ist, als eine Dimension der Freiheit. Der Hauptsitz der ILO ist seit 1919 (mit einer Unterbrechung während des Zweiten Weltkriegs) Genf. Zu den jährlich stattfindenden International Labour Conferences entsandten die Mitgliedstaaten nach dem Prinzip des tripartism Regierungsdelegierte sowie Vertreter der Sozialpartner (Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften). Auf deren Konferenzen wurden in den ersten Jahren Arbeits- und Sozialstandards definiert und zahlreiche Konventionen zum Arbeitsschutz sowie zu bürgerlichen und sozialen Rechten verabschiedet. Das angegliederte International Labour Office wiederum versteht sich als social library und half in der Zwischenkriegszeit ebenso bei der Formulierung der Standards wie es auch die Implementierung der Konventionen überprüfte. Diese Agenda hat sich seither nicht grundlegend verändert, wenngleich seit der Weltwirtschaftskrise von 1929 und dem Beitritt der USA 1934 wirtschaftspolitische Fragen an Bedeutung gewonnen haben (und zugleich immer mehr nicht-europäische Mitglieder beitraten).[21]
Zahlreiche europäische Staaten sind seit der Gründung der ILO deren Mitglieder, so neben Frankreich und Großbritannien auch Polen und Tschechoslowakei bzw. die Tschechische und die Slowakische Republik, Belgien und Dänemark, seit 1920 Bulgarien und Finnland, seit 1922 Ungarn, von 1934 bis 1940 sowie seit 1954 die Sowjetunion / Russland und zahlreiche ehemalige Sowjetrepubliken, von 1919 bis 1935 sowie seit 1951 Deutschland, von 1919 bis 1938 Österreich; und das sind nicht alle.[22]
Wie aus dieser Aufstellung hervorgeht, war die Mitgliedschaft im Völkerbund keine zwingende Voraussetzung für die Mitgliedschaft in der ILO. Die genannten Staaten waren mit Ausnahme Ungarns, das erst 1955 beitrat, auch Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen, die als Nachfolgeorganisation des Völkerbunds firmiert. [23] Der Begriff der sozialen Gerechtigkeit wurde in deren Menschenrechtserklärung von 1948 proklamiert. Artikel 22 bis 27 der dort festgeschriebenen UN-Sozialcharta definiert soziale Sicherheit als eine Dimension der Menschenwürde. Jeder solle demnach (Artikel 22) soweit Zugang zu wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten haben, wie dies „für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich“ ist. Soziale Sicherheit wird hier wesentlich über Arbeit hergestellt: Proklamiert werden (Artikel 23) das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit, auf gerechten und gleichen Lohn und auf gewerkschaftliche Organisation.[24] Hier lässt sich wie schon im Völkerbund eine Fixierung auf Erwerbsarbeit feststellen. Dies berührt auch die Frage der Familienorganisation sowie die Erwerbsbeteiligung von Frauen. Die Ausgestaltung lag auf internationaler Ebene wiederum bei der ILO (die Umsetzung oblag sowohl im Falle der UN als auch im Falle der ILO den Mitgliedstaaten). Diese nahm sich trotz entsprechender Vorläufer in der Zwischenkriegszeit[25] erst nach dem Zweiten Weltkrieg systematischer der Erwerbsarbeit von Frauen an, indem sie die zugrunde gelegten Normen mitreflektierte und zum Teil erweiterte. So wurden nun z.B. auch mithelfende Familienangehörige in den Blick genommen und mit der ILO-Konvention Nr. 100 von 1956 wurde gleicher Lohn für gleiche Arbeit proklamiert.[26] An zahlreichen UN-Frauenkonferenzen mit einer weitreichenden Agenda hatten wiederum auch die sozialistischen Staaten teil.[27]
Soziale Sicherheit ist also in der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen seit 1948 als eine Dimension der Menschenwürde definiert und damit universell wie normativ gesetzt. Dieses Verständnis war auch grundlegend für alle weiteren Erklärungen insbesondere auf europäischer Ebene, und zwar – und dies ist für die Analyse der neuesten Entwicklungen wichtig – grundsätzlich über die Systemgrenzen hinweg. Dies manifestierte sich insbesondere im Kontext der Entspannungspolitik in den 1970er Jahren. So bekannten sich in der Schlussakte von Helsinki (1975) die unterzeichnenden Staaten schon im ersten Satz unter Berufung auf die Vereinten Nationen auf die „Verpflichtung zu Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit“, genau in dem eben skizzierten Verständnis. Die KSZE begründete die OSZE, die sich noch heute als Organisation zur Friedenssicherung in Europa versteht und der von Beginn an fast alle europäischen Staaten inklusive Russland und den USA angehören.
Menschenrechte wurden in dieser Zeit auch zu einem zentralen Anliegen des Vatikans. So hielt Johannes Paul II 1979 vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen eine Rede, die das grundlegende Bekenntnis der katholischen Kirche zu denselben enthielt.[28] Menschenrechte und mithin soziale Sicherheit als einer hauptsächlich über Arbeit vermittelten Dimension der Menschenwürde, wie sie in der Sozialcharta deklariert wurden, war mithin keine Systemfrage. In ihrer Ausrichtung auf den Friedenserhalt war und ist sie – auch in der Tradition der Zwischenkriegszeit – notwendigerweise international.[29]
Derweil vereinten die europäischen Institutionen, die EU und der Europarat, zunächst nur die westeuropäischen bzw. die nicht-sozialistischen Staaten.[30] Erst mit dem Übergang zu Demokratie und freier Marktwirtschaft wurde hier über eine Teilhabe der vormals sozialistischen Staaten verhandelt.[31] Grundsätzlich bekennen sich auch die europäischen Institutionen zu der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationalen; der Europarat hat darüber hinaus 1961 eine europäische Sozialcharta verabschiedet, die sich daran anlehnt.[32] Nichtsdestoweniger spielen soziale Rechte, soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit eine untergeordnete Rolle in den europäischen Institutionen. Gerade im Transformationsprozess wurden Freiheitsrechte dagegen stark aufgewertet.
Das Ende des Kalten Krieges, Arbeit und Gender
Im Prozess der Systemtransformation diskreditierten zahlreiche Expert*innen und Politiker*innen den Anspruch auf soziale Absicherung als eine Haltung, die aus dem sozialistischen Staatspaternalismus resultiere. Die Menschen in den post-sozialistischen Ländern seien zu Unselbstständigkeit und Unmündigkeit erzogen worden; nun seien sie unfähig zu staatsbürgerlichen und ökonomischen Initiativen; der entsprechende Typus wurde als Homo Sovieticus geführt.[33] Diese Argumentation basiert auf einem Denken in binären Gegensatzpaaren wie es für die politische Kultur des Kalten Kriegs charakteristisch war. Sie übersieht, dass die Systemkonkurrenz zwischen Sozialismus und Kapitalismus auch als ein Wettstreit um soziale Standards geführt wurde, dass das Standard-Setting über die ILO von einer blockübergreifenden Institution initiiert wie überprüft wurde, und dass schließlich die sozioökonomischen Bedingungen im „Westen“ viel besser gewesen waren als in den sozialistischen Volksdemokratien.[34]
Es waren nicht nur die vermeintlich neoliberalen westlichen Berater, die gleich 1989 gegen ein Zuviel an sozialer Sicherung argumentierten, vielmehr waren marktliberale Haltungen auch unter den osteuropäischen Akteur*innen stark verbreitet.[35] Eine radikale Abkehr vom sozialistischen System und eine leidenschaftliche Hinwendung zur Freiheit unter Preisgabe sozialer Sicherheit schienen das Gebot der Stunde. Staatliche Legitimität fußte nun nicht mehr auf der Gewährleistung sozialer Rechte, sondern auf der Durchsetzung liberaler Ideen von Freiheit und Wettbewerb. Dabei ging man davon aus, dass Kapitalismus und Demokratie mehr oder weniger zwangsläufig zu mehr Wohlstand führen würden, an dem letztlich jeder, der sich irgend mühte, partizipieren könnten. Im Bemühen insbesondere der polnischen Akteure etwa um Aufnahme in den Europarat wurde Anfang der 1990er Jahre die Überwindung des Staatssozialismus hervorgehoben und im Sinne eines Bekenntnisses zur Freiheit ausgedeutet.[36] Freiheit wurde dabei auch als Freiheit des Marktes verhandelt, welche in der entsprechenden Rhetorik nicht mit staatlicher Verteilungsmacht in Einklang zu bringen war.[37] Dies war umso problematischer, als dass zugleich große Teile der Bevölkerung vom Arbeitsmarkt verdrängt wurden. [38] Besonders seit der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 setzt sich dagegen immer klarer die Einsicht durch, dass die Gleichsetzung von wirtschaftlicher und politscher Freiheit auf falschen Prämissen beruhte.[39]
In der Phase der zunehmenden Delegitimierung des Sozialismus wurden die Internationalen Organisationen durch die oppositionellen Bewegungen auf die Probe gestellt. Die polnische Gewerkschaftsbewegung Solidarność forderte das sozialistische Regime in einer besonderen Weise heraus, da sich hier die Arbeiter*innen, einst das Kernklientel der Sozialisten, unabhängig der staatlich kontrollierten Gewerkschaften formierten und gegen die Nomenklatura wandten.[40] Für die ILO stellte dies aufgrund ihres Organisationsprinzips, des tripartism, eine besondere Schwierigkeit dar. Nach heftigen Diskussionen setzte sich hier nach der Anerkennung der Solidarność in Polen (August 1980) die Auffassung durch, die Vertreter derselben und nicht die der kommunistischen Parteien seien als Delegierte anzuerkennen. Nach der Proklamation des Kriegsrechts im Dezember 1981 führte dies schließlich zu einem Eklat, der in einem Ausschlussverfahren Polens aus der ILO geendet wäre, hätte sich nicht 1989 der Regimewechsel vollzogen.[41] Mit dem Regimewechsel jedoch setzte ein Umdeutungsprozess ein, innerhalb dessen Solidarność nicht länger als Gewerkschaft, sondern als eine Freiheitsbewegung galt.[42] Daran waren die Führer derselben maßgeblich beteiligt. Während die Forderungen der Arbeiter 1980 klar an ein sozialistisches Regime gerichtet gewesen waren und diese keineswegs einen Umsturz planten, sondern vielmehr die proklamierten sozialen und politischen Rechte innerhalb des Sozialismus einforderten,[43] wurde nun Solidarność im Sinne der Systemtransformation aktiv überhöht und so aus dem Sozialismus heraus und in eine neue Zeit der politischen und ökonomischen Freiheit überführt. Am sinnfälligsten lässt sich dies an Lech Wałęsas vielgeachtete Rede vor dem Kongress der USA im November 1989 festmachen.[44]

November 15, 1989 – Washington, District of Columbia, U.S – Polish Solidarity leader and Nobel Peace Prize winner Lech Walesa addresses a joint session of the US Congress in Washington DC., November 15, 1989. Washington U.S. Copyright: xMarkxReinsteinx; Photo credit: IMAGO / ZUMA Wire
Der polnische Gewerkschaftsführer schrieb hier Solidarność in einen universellen von den USA angeführten Kampf um Freiheit ein und inszenierte sich selbst als Held. In seiner Person verbanden sich für diesen Moment die Figur des Arbeiters (genaugenommen des Elektrikers) mit der des Freiheitskämpfers. Der Freiheitskampf war in seiner Ansprache polnisch, amerikanisch und universell gleichzeitig; Ost und West verbanden sich dieser Rhetorik gemäß in der Niederringung des Sozialismus. Im Arbeiter-Helden verband sich das sozialistische und das post-sozialistische Ideal. Der entsprechende Kampf verlor zugleich seine Anbindung an die Arbeiterschaft. Solidarność hörte auf eine Gewerkschaft, eine Interessenvertretung der Arbeiter (und zum Teil Arbeiterinnen), zu sein und wurde so aus ihrem sozialistischen wie auch aus dem internationalen Entstehungskontext herausgelöst.[45] Die Vorstellungen von Würde und Rechten der Arbeiter wurde in gleichem Maß von der Idee der sozialen Sicherheit entkoppelt, wie der Kampf Wałęsas und der Solidarność als ein Freiheitskampf in Szene gesetzt wurden.
Die Entstehung und Umdeutung der Gewerkschaftsbewegung Solidarność fiel in eben jenen Zeitraum, in welchem auch die Wirkkraft der ILO erheblich nachließ. Dies geschah im Kontext der Abwendung vom Keynesianismus und der Hinwendung zu der konkurrierenden Chicagoer Schule, welche eine Laissez-Faire Politik propagierte und staatliches Handeln zurückdrängen wollte, in Hinwendung also zu einer Politik, die heute unter dem Schlagwort Neoliberalismus verhandelt wird.[46] Dies ging von den USA und Großbritannien (unter Reagan und Thatcher) aus und erfuhr mit dem Ende des Sozialismus eine erhebliche Erweiterung.[47] In eben jener Zeit der Entfaltung freier Marktwirtschaft litten auch internationale Arbeits- und Sozialstandards erheblich, da sich die ILO bei zahlreichen Regierungen kaum mehr Gehör verschaffen konnte und da sich seither die Arbeiter zunehmend weniger gewerkschaftlich organisieren (und Arbeiterinnen noch weniger).[48]
Was die Geschlechternormen betrifft, so haben wir es in der fraglichen Zeit mit zwei gegeneinander laufenden Tendenzen zu tun. Im Lichte von De-Industrialisierung[49] und hoher Arbeitslosigkeit schien es im ökonomischen Transformationsprozess opportun, Frauen durch familienpolitische Anreize vom Arbeitsmarkt fernzuhalten (wie dies durchaus den Vorstellungen der Solidarność und anderer oppositioneller Bewegungen entsprach, die ohnehin männlich dominiert waren).[50] Dies galt zugleich politisch als eine Abkehr von staatlich verordneter Emanzipation und alltäglicher Doppelbelastung von Frauen.[51] Die in den europäischen Sozialpolitiken angelegte Fixierung auf Arbeit als Voraussetzung auch für den Zugang zu Sozialleistungen und zugleich auf den männlichen Arbeiter blieb mithin erhalten; Frauen waren in dieser Logik primär über Ehe und Mutterschaft und erst sekundär über eigene Einkünfte sozial abgesichert.[52] Frauenemanzipation, verstanden als gleichwertige Erwerbsbeteiligung von Frauen, galt dagegen als ein zu überwindendes Erbe des Staatssozialismus. Diese Anschauung übersah jedoch die fortwährenden international entfalteten Bemühungen um den Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt und zu sozialen Gütern, etwa innerhalb der UN.[53] Während man also an die konservative (und national codierte) Logik der frühen Sozialversicherungssysteme anknüpfte, bleiben die sich seither parallel entfaltenden europäischen und weltweiten Bemühungen um Gleichberechtigung weitgehend unberücksichtigt. Dies stellt das grundlegende Hindernis für die Entfaltung trans- und internationaler Solidaritätsoptionen dar. Mit der Ausblendung und Umdeutung des sozialistischen Erbes geriet zugleich aus dem Blick, dass es schon seit dem späten 19. Jahrhundert gemeinsame Entwicklungslinien europäischer Sozialpolitiken gab, an die man durchaus hätte anknüpfen können und immer noch könnte.
Resümee
In diesem Essay wurden Traditionen europäischer Sozialpolitiken in einer longue-durée Perspektive dargelegt. Mit Blick auf die Habsburgermonarchie und ihre Nachfolgestaaten sowie die Entstehung und Genese Internationaler Organisationen, vor allen der ILO, wird dabei gezeigt, dass es neben nationalen auch trans- und internationale sozialpolitische Traditionen gibt, die in ihrer Summe das Europäische des Phänomens ausmachen. Entlang dieses Gedankengangs werden zwei Argumente entfaltet: erstens gibt es eine Kontinuität sozialpolitischer Institutionen, Erwartungshaltungen und Denktraditionen; zweitens sind aber die Konturen derselben kaum sichtbar. Als Grund hierfür identifiziert der Essay die Hinwendung zum Neoliberalismus, welche das Denken des Kalten Krieges wie insbesondere den Systemwechsel vom Sozialismus zum Post-Sozialismus prägte. Illustriert wird dies anhand der Bedeutung von Arbeit, insbesondere mit Blick auf Gendernormen. Als Beispiel dient die polnischen Gewerkschaftsbewegung Solidarność. Die Überwindung des Staatssozialismus, verstanden als Rückkehr zu nationalen Traditionen, führte zu einer Verengung des Blicks, wodurch Traditionen progressiver (internationaler wie auch zeitversetzt geschlechtergerechter) Sozialpolitik aus dem Blick gerieten. Es gibt sie aber.
Notes & References
[1] Monika Eigmüller, Nikola Tietz, A ‚socio-histoire’ of Europeanization: Perspectives for a diachronic comparison; SEU Working Papers 8/2014, 2; Christoph Conrad, Social policy history after the transnational turn, in: Pauli Kettunen, Klaus Petersen, Beyond Welfare State Models. Transnational History Perspektives on Social Policy, Cheltenham: Edward Elgar 2011, 218–240, hier 218.
[2] Christoph Conrad, Was macht eigentlich der Wohlfahrtsstaat? Internationale Perspektiven auf das 20. und 21. Jahrhundert, in: Geschichte und Gesellschaft 39 (2013), 555–592, hier 563; Philipp Ther, Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Eine Geschichte des neoliberalen Europa, Suhrkamp: Berlin 2014.
[3] Ann Orloff, Gender in the Welfare State, in: Annual Review of Sociology 22 (1996), 51–78.
[4] Gösta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, New Jersey: Princeton University Press 1990; ders., Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford: Oxford University Press 1999.
[5] Jolanta Aidukaite, Old Welfare State Theories and New Welfare Regimes in Eastern Europe, in: Communist and Post-Communist Studies 42/ 1 (2009), 23–39.
[6] Zur Bedeutung der Habsburgermonarchie für die internationale Ordnung vgl.: Natasha Wheatley, Central Europe as a Ground Zero oft e New International Order, in: Slavic Review 78/4 (2019), 900–911; Sascha O. Becker, Katrin Boeckh, Christa Hainz, Ludger Woessmann, The Empire is Dead, Long Live the Empire! Long-Run Persistence of Trust and Corruption in the Bureaucracy (March 24, 2011). CESifo Working Paper Series No. 3392, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1793772 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1793772.
[7] Béla Tomka, Welfare in East and West. Hungarian Social Security in an International Comparison, 1918-1990, Berlin: Akademie Verlag 2004, 50–61; Tomasz Inglot, Welfare States in East Central Europe, 1919–2004, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 54–118.
[8] Examplarisch: Sigrid Wadauer, Establishing Distinctions: Unemployment Versus Vagrancy in Austria from the Late Nineteenth Century to 1938, in: International Review of Social History 56/1 (2011), 31–70; Natali Stegmann, Versehrte Bürger: Kriegsbeschädigtenfürsorge in Polen und der Tschechoslowakei in den ersten Nachkriegsjahren, in: Ulrike Harmat (Hg.), Das Erbe der Habsburgermonarchie in den Nachfolgestaaten: Brüche und Kontinuitäten (Sonderband zur Reihe: Die Habsburgermonarchie 1848–1918; im Druck).
[9] Verena Pawlowsky, Harald Wendelin, Die Wunden des Staates. Kriegsopfer und Sozialstaat in Österreich 1914-1938, Wien: Böhlau 215; Julia Eichenberg, Paul Newman (Hg.), The Great War and Veterans’ Internationalism, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2013.
[10] Pieter M. Judson, Habsburg: Geschichte eines Imperiums, 1740-1918, München: Beck 2017, 17–18, 26, 34–36h.
[11] Nancy Fraser, Axel Honneth, Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003, 15–16; Reinhard Koselleck, „Erfahrungsraum“ und „Erwartungshorizont“ – zwei historische Kategorien, in: Ders., Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1989, 349–375.
[12] Dieter Gosewinkel, Schutz oder Freiheit? Staatsbürgerschaft in Europa im 20. und 21. Jahrhundert, Berlin: Suhrkamp 2016, 141–167; Wheatley, Central Europe as a Ground Zero, 906–908.
[13] Zsusza Ferge, Is There a Specific East Central European Welfare Culture? in: Wim von Oorschot, Michael Opiellka, Birgit Pfau-Effinder (Hg.), Culture and Welfare State. Values of Social Policy from a Comparative Perspective, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008, S. 141–161 here 147–149; Sabine Hering (Hg.), Social Care under State Socialism (1945–1948). Ambitions, Ambiguities, and Mismanagement, Opladen: Verlag Barbara Budich 2009.
[14] Akira Iriye, Historicizing the Cold War, in: Richard H. Immerman, Petra Goedde (Hg.), The Oxford Handbook of the Cold War, Oxford: Oxford University Press 2013, 15–31; Sandrine Kott, Cold War Internationalism, in: Glenda Sluga, Patricia Clavin (Hrsg.), Internationalisms. A Twentieth-Century History, Cambridge: Cambridge University Press 2017, 340–362, hier 352–356; Bren, Paulina. Looking West: Popular Culture and the Generation Gap in Communist Czechoslovakia 1969–1989, in: Luisa Passerini (Hg.), Across the Atlantic: Cultural Exchanges between Europe and the United States, Berlin: Peter Lang, 2000, 295–321.
[15] Susan Zimmermann, Wohlfahrtspolitik und staatssozialistische Entwicklungsstrategie in der ‘anderen’ Hälfte Europas im 20. Jahrhundert, in: dies., Johannes Jäger, Gerhard Melinz (Hg.), Sozialpolitik in der Peripherie: Entwicklungsmuster und Wandel in Lateinamerika, Afrika, Asien und Osteuropa, Vienna: Brandes & Apsel 2001, 211–237; Sandrine Kott, The Social Engineering Project. Exportation of Capitalist Management Culture to Eastern Europe (1950–1980), in: Christian, Michel, Kott, Sandrine and Matejka, Ondrej (Hg.), Planning in Cold War Europe: Competition, Cooperation, Circulations (1950s-1970s), Berlin u.a.: De Gruyter Oldenbourg, 2018, 123–141. https://doi.org/10.1515/9783110534696; Besnik Pula, Globalization Under and After Socialism. The Evolution of Transnational Capital in Central and Eastern Europe, Stanford: Stanford University Press 2018.
[16] Dietrich Beyrau, Schlachtfeld der Diktatoren. Osteuropa im Schatten von Hitler und Stalin. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2000; Toni Judt, Postwar. A history of Europe since 1945, London: Vintage 2010, 13–62.
[17] Barbara Einhorn, Cinderella Goes to Market. Citizenships, Gender and Women’s Movements in East Central Europe, London / New York: Verso 1993, 17–38.
[18] „Deutsch“ meint im Kontext der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert auch deutsch-österreichisch bzw. habsburgisch; Sandrine Kott, Constructing a European Social Model: The Fight for Social Insurance in the Interwar Period, in: Jasmien Van Daele, Magaly Rodriguez Garcia, Geert van Goethem, Marcel van der Linden (Hg.), ILO Histories. Essays on the International Labour Organization and Its Impact on the World During the Twentieth Century, Bern .u.a.: Peter Lang 2010 173–195; Natali Stegmann, The Work of the ILO and East Central Europe: Insights into the Early Polish and Czechoslovak Interwar Years, in: Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia 17/1 (2017), 11–34, 13.
[19] Zara Steiner, The Lights that failed. European International History 1919–1933, Oxford: Oxford Universitiy Press 2005; Patricia Clavin, Europe and the League of Nations, in: Robert Gerwarth (Hg.): Twisted Paths: Europe 1914–1945, Oxford: Oxford University Press 2007, 325–354; Magaret MacMillan, Friedensmacher. Wie der Versailler Vertrag die Welt veränderte, Berlin: Ullstein 2015 (zuerst erschienen unter dem Titel: Peacekeepers. Six month that Changed the World, London 2001); John Horne, The European Moment between the Two World Wars (1924–1933), in: Madelon de Keiser, Sophie Tates (Hg.), Moderniteit. Modernisme en massacultuur in Nederland 1914–1940, Zutphen: Walburg Pers 2004, 223–240; Jay Winter, Dreams of Peace and Freedom. Utopian Moments in the 20th Century. New Haven u.a. 2006.
[20] The Versailles Treaty, June 28, 1919, Part XIII – Preamble, The Avalon Project. Documents in Law, History and Diplomacy, Yale Law School, http://avalon.law.yale.edu/imt/partxiii.asp, eingesehen am 7.2.2022.
[21] Daniel Maul, The International Labour Organization. 100 Years of Global Social Policy, Berlin: de Gruyter 2019, 85–92.
[22] ILO Country profiles, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11003:0::NO, eingesehen am 7.2.2022.
[23] Ebd.
[24] Die Charta der Vereinten Nationen, https://unric.org/de/charta, eingesehen am 7.2.2022.
[25] Françoise Thébaud, Difficult Inroads, Unexpected Results. The Correspondence Comittee on Women’s Work in the 1930s, in: Eileen Boris, Dorothea Hoehtker, Susan Zimmermann (Hg.): Women’s ILO. Transnational Networks, Global Labour Standards and Gender Equality, 1919 to Present, Geneva: International Labour Organization 2018, 50–74.
[26] Glenda Sluga, Women, Feminists and Twentieth Century Internationalisms, in: Dies., P Clavin (Hg.), Internationalisms, 68–75; Thébaud, Difficult Inroads.
[27] Celia Donert, Feminism, Communism, and Global Socialism, 1968–1995: Encounters and Entanglements’, in: Juliane Fuerst, Silvio Pons, Mark Selden (Hg.) The Cambridge History of Communism, Bd. 3, Cambridge: Cambridge University Press 2017, 399–421; Kristin Ghodsee, Second World, Second Sex: Socialist Women’s Activism and Global Solidarity during the Cold War, Durham: Duke University Press 2019.
[28] Ohne Menschenrechte keimt und reift die Kriegslust. Aus der Rede von Papst Johannes Paul II vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen, in: Die Welt, Nr. 232, 4. Oktober 1979, 8.
[29] Holger Nehring, Helge Pharo, Introduction: A Peaceful Europe? Negotiating Peace in the Twentieth Century, in: Contemporary European History, 17/3 (2008), 277–299.
[30] Mitglieder Europarat (mit Eintragungen über Beitrittsdaten): https://www.coe.int/de/web/portal/47-members-states, eingesehen am 6.2.2022; zur EU: https://www.schengenvisainfo.com/countries-in-europe/eu-countries/, eingesehen am 6.2.2022.
[31] Die Konzentration auf ökonomische (und übergeordnete politische) Fragen zeichnet sich beispielhaft in folgendem Report ab: Grzegorz Gorzelak, Éva Ehrlich, Lubomir Faltan, Michal Illner (Hg.), Central Europe in Transition? Warschau 2002.
[32] https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=035, eingesehen am 6.2.2022.
[33] Ferge, Is there a specific, 142-152; Brian Porter-Szűcs, From Homo Sovieticus to Homo Economicus : The Transformation of the Human Subject in Polish Socialist Economic Thought, in: East European Politics & Societies 34/3 (2019), DOI: 10.1177/0888325419875992.
[34] David F. Good, The State and Economic Development in Central and Eastern Europe, in: Alice Teichova, Herbert Matis, Jaroslav Pátek (Hg.): Nation, State and the Economy in History. Cambridge 2003, 133–158, hier 136–142.
[35] Dies gilt für die Dissidenten ebenso wie etwa für die Ökonomen und verschiedenen liberale Kräfte; vgl: Johanna Bockman, Markets in the Name of Socialism. The Left-Wing Origins of Neoliberalism; Stanford. Stanford University Press 2011, 157–214.
[36]Application by Poland for membership of the Council of Europe; https://pace.coe.int/en/files/13893/html, eingesehen am 7.2.2022.
[37] Ther, Die neue Ordnung, 320–323.
[38] Zsuzsa Ferge, Endre Sik, Péter Róbert, Fruzsina Albert, Social costs of transition. A survey carried out as part of the SOCO project initiated and coordinated by the Institute for Human Studies, Vienna. Cross-national report on five countries, prepared by IWM, Vienna, 1995 (unveröffentliches Manuskript); http://www.fergezsuzsa.hu/docs/social_costs_of_transition.pdf (eingesehen am 3.2.2022).
[39] Jochen Roose, Moritz Sommer, Franziska Scholl, Krise und Zivilgesellschaft Potenziale und Herausforderungen der zivilgesellschaftlichen Rolle in der Eurozonen-Krise, in: dies. (Hg.), Europas Zivilgesellschaft in der Wirtschafts- und Finanzkrise, Bürgergesellschaft und Demokratie, https://doi.org/10.1007/978-3-658-20897-4_1; Manlio Cinalli and Marco Giugni, How did European Citizens Respond to the Great Recession? A Comparison of Claims Making in Nine European Countries, 2008–2014, ebd; Ther, Die neue Ordnung, 226–237.
[40]Jan Kubik, The Power of Symbols against the Symbols of Power: The Rise of Solidarity and the Fall of Socialism in Poland, Pennsylvania, PA: Penn State University Press 1994; Grzegorz Ekiert, The State against Society. Political Crisis and Their Aftermath in East Central Europe, Princeton: Princeton University Press 1996, 215–304; Melanie Tatur, Solidarność als Modernisierungsbewegung: Sozialstruktur und Konflikt in Polen, Frankfurt/Main: Campus Verlag 1989.
[41] Idesbald Goddeeris, The Limits of Lobbying: ILO and Solidarność, in: Van Daele u.a. (Hg.), ILO Histories, 423–441.
[42] Besonders sprechend die Erschließung des Europäischen Parlaments zum 25. Jahrestag: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2005-0357_EN.html, eingesehen am 6.2.2022.
[43] Karol Modzelewski, Zajeździmy kobyłę historii: Wyznania poobijanego jeźdźda, Warschau: Wydawnictwo Iskry, 2013, 120; Natali Stegmann, „Für Brot und Freiheit“. Zum Verhältnis von materiellen und ideellen Erwartungen im „Langen Sommer der Solidarność“, in: Jana Osterkamp, Joachim von Puttkamer (Hg.), Sozialistische Staatlichkeit, München: Oldenbourg 2012, 161–174, hier 166–171.
[44] Congressional Record – House of Representatives, Wednesday, November 15, 1989, http://GPO-CRECB-1989-pt20-5-1.pdf, 28969–28072; Lech Wałęsa, My, naród / We the People, http://10-25.pl/my-narod/ eingesehen am 8.2.2022.
[45] Zur symbolischen Überhöhung Wałęsas: Robert Brier. Poland’s Solidarity Movement and the Global Politics of Human Rights, Cambridge: Cambridge University Press 2021, 173–185.
[46] Maul, The International Labour Organization, 241–248.
[47] Ferge, Is there a specific, 150-151; Bockman, Markets in the Name of Socialism, 170–173; Dorothee Bohle, Béla Greskovits. Capitalist Diversity on Europe’s Periphery. Ithaca/London. Cornell University Press 2012, 82–95.
[48] Maul, The International Labour Organization, 248–260.
[49] Andy Pike, Deindustrialization, in: Audrey Kobayashi (Hg.), International Encyclopedia of Human Geography, Amsterdam: Elsevier 2020 (zweite Auflage), 213–222, bes. 217–218.
[50] Susan Gal, Gail Kligman, The Politics of Gender after Socialism. A Comparative-Historical Essay, Princeton: Princeton University Press 2000; Claudia Kraft, Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen: Die Rolle der Kategorie Geschlecht in den Demokratisierungsprozessen in Ost- und Westeuropa seit 1968, in: L’ Homme 20 (2009) 2, 13–30; Einhorn, Cinderella, 113–147.
[51] Kraft, Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, 18-22; Robert Brier, Gendering Dissent: Human Rights, Gender Histroy and the Road to 1989, in: L’homme 28/1 (2017), 15–32.
[52] Birgit Pfau-Effinger; Development of Culture, Welfare States and Women’s Employment in Europe: Theoretical Framework and Analysis of Development Paths. New York: Taylor & Francis 2016; Orloff, Gender in the Welfare State, 69–73.
[53] Ute Gerhard, Für eine andere Gerechtigkeit. Dimensionen feministischer Rechtskritik, Frankfurt am Main / New York: Campus 2018, 97–129; zur EU: Pollack, Mark A. Emilie Hafner-Burton, Mainstreaming Gender in the European Union, in: Journal of European Public Policy 7, 3, 432–456.